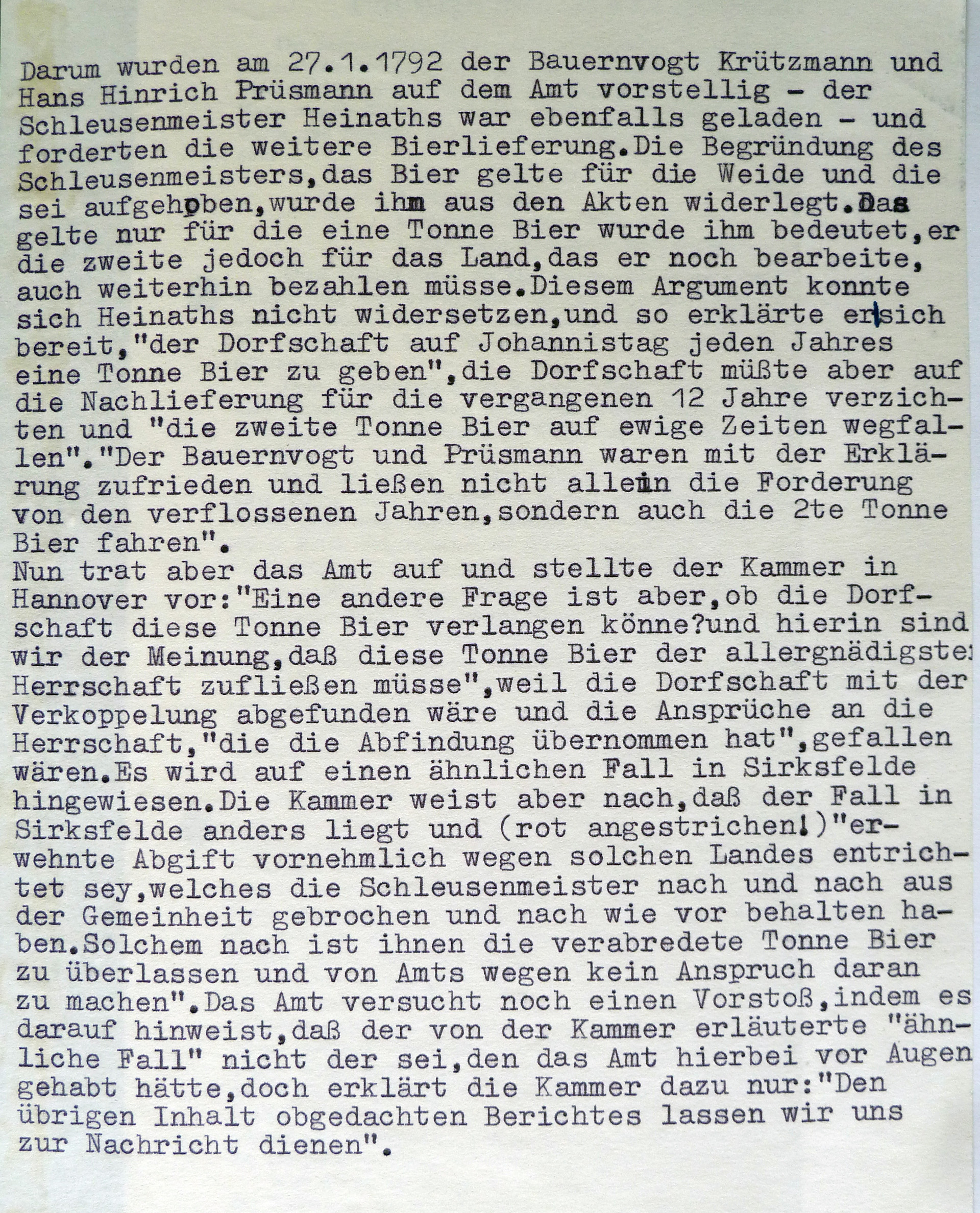Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war die Abgabe des Zehnts, der ab dem 6. Jahrhundert von der Kirche als größtem Landbesitzer erhoben wurde, die vorherrschende Form der Steuer. Er bezeichnete den zehnten Teil aller aus Grundbewirtschaftung erzielten Erträge und hatte somit Merkmale einer Einkommenssteuer. Dieser Naturalzehnt verwandelte sich später in eine Geldabgabe. Nicht viele konnten den Besitz erwirtschafteter Güter, wie Vorräte oder Vieh oder gar Landbesitz vorweisen. Da es aber keine verwaltungstechnischen Möglichkeiten gab, Einkommen zu berechnen, setzte man für besitzlose Leibeigene oder Pächter einen bestimmten Betrag fest, den sie durch körperliche Arbeit bei der Feldbestellung oder Ernte erbringen mussten.
Der Landbesitz, ob Eigentum oder als Lehen, wurde grundsätzlich mit einem Grund- oder Lehenszins belegt. Landesherrlich angeführte Hubsteuern auf den Landbesitz – z.B.: freier Bauern – waren die sogenannten Urbaren.
Neben Abgaben und Zins traten ab dem 12. u. 13. Jahrhundert Steuern, die in Geld zu leisten waren: Im Rahmen der Grundherrschaft – Grundsteuer, der Leibherrschaft – Leibsteuer, der Schutzherrschaft (durch eine Vogtei) Vogtsteuer, durch den Kaiser – Reichssteuern -. Dieses waren außerordentliche Steuern, die bei besonderem Bedarf, wie etwa Krieg, Katastrophen, herrschaftlichen Hochzeiten oder Landesverteidigung erhoben wurden. Im Mittelhochdeutschen hießen sie stiure, lateinisch petitio = erbetene Beihilfe.
Ein Beispiel für eine solch außerordentliche Reichssteuer ist die Bartsteuer, die der russische Zar Peter der Große erheben ließ. Da er ein modernes Russland wünschte, störten ihn die gewaltigen Bärte seiner männlichen Untertanen. Wer also seinen Bart behalten wollte, musste zahlen. Als eine Art Quittung erhielt er eine besondere Münze. Nur, wer diese Münze bei sich führte, konnte einer öffentlichen Zwangsrasur entgehen.
Eine ebenso einzigartige wie bemerkenswerte Form der Zahlung eines Pachtzinses beschreibt die folgende Abhandlung über die Vereinbarung der Gemeinde Kühsen mit dem Schleusenmeister der Donnerschleuse (ehemals Niederschleuse), die sich vorwiegend im 18. Jahrhundert ereignete – viel Spaß bei der Lektüre.
Quelle:
BR.de - Geschichte der Steuern
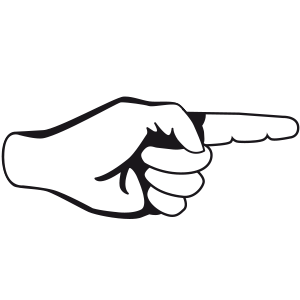
Mit einem Doppelklick/ Doppeltippen zwischen Textansicht und Orinaldokument umschalten.
Pachtpreis: 2 Tonnen Bier
----------------------------
Der ursprüngliche Name der Donnerschleuse ist „Niederschleuse“ (im Gegensatz zu „Oberschleuse“, die sich etwa bei der Steinaumündung befand) gewesen. Ein im Kreisarchiv liegendes Aktenstück vom 21.10.1672 besagt, dass an diesem Tage ein „damals 92jähriger Mann namens Joachim Niemann aus Kühsen bürtig, Schweinehirte zu Klempau“, verhört wurde, der aussagte dass er vier Schleusenmeister auf dieser Schleuse gekannt habe, und zwar:
„1. Asmus Hellenstedt
2. Hans Jarmann
3. Heinrich Donner, Vater des
4. damaligen Schleusenmeisters Donner.“
„Diese Donner gaben der Schleuse den zuletzt am meisten üblichen Namen „Donnerschleuse“ und sind wie bekannt, die Vorfahren der reichen zu Altona wohnhaften Donnerschen Familie“, sagt hierzu eine andere Akte vom 24.2.1868. Seit den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts hatte die Familie Heynaths (ursprüngliche Enaths) diese Schleusenstelle inne.
Dem Vermessregister zu Kühsen zufolge gehörten zu dieser Schleusenmeisterstelle 3434 Quadratruthen Acker, 933 Quadratruthen Wiesen, 182 Quadratruthen Hecken und Graben (?) und 28 Quadratruthen an Wegen und Fußsteigen. In Summa 38 Morgen 17 Quadratruthen. „Hier muss bemerkt werden, dass das Vermessregister Kühsen aus dem Jahre 1778 die Zahlen nicht nachweist. Es ist hier kein Schleusenmeisterland verzeichnet und konnte nicht festgestellt werden, auf welches Verzeichnis sich diese Akte von 1868 stützt. Welche Bewandtnis es mit diesem Land gehabt hat, ist aber auch damals schon nicht klar gewesen, wie weiter aus dem Schriftstück hervorgeht.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts zahlten die Schleusenmeister zur Donnerschleuse 1 Rthlr. Grundhäuser an das Ratzeburgische Amts-Geldregister. Diese Grundhäuser fiel aber kurze Zeit später wieder weg, „nachdem ihnen, wie es scheint ein Strich Land wofür sie… zu zahlen hatten, wieder genommen und den Kühsenern gegeben worden. Seit alten Zeiten zahlen die Schleusenmeister noch eine Pachtabgabe von 18 ½ Schilling Lübsch Courant“. Es ist nicht bekannt, wofür diese Abgabe zu entrichten war.
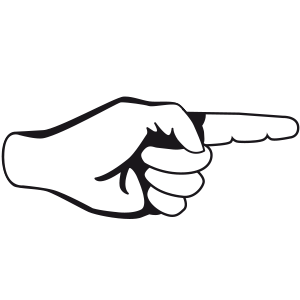
Mit einem Doppelklick/ Doppeltippen zwischen Textansicht und Orinaldokument umschalten.
Dagegen scheint mit Sicherheit festzustehen , dass das Land, das die Schleusenmeister zur Donnerschleuse inne hatten, ehemals Kühsener Freiweiseland gewesen ist. Für die Mitbenutzung dieser Freiweide musste an die Dorfschaft Kühsen jährlich eine Tonne Bier entrichtet werden. Nach dem Aktenstück von 1868 ist es sicherlich der erwähnte Schleusenmeister Heinrich Donner (um 1650) gewesen, der mit Genehmigung des Bauernvogtes etwas Gemeindeland auf dem sog. Heidberg „zu Acker urbar gemacht“ hat. Seine Nachfolger haben das allmählich ausgedehnt. Im Jahre 1737 betrug die auf diese Weise von den Schleusenmeistern in „Benutzung genommene“ Freiweide „bereits 30 Scheffel Einfall“ (rd. 4 ha). Darum wurde durch eine Resolution des Amtes Ratzeburg vom 27.8.1737 verfügt, dass „die Schleusenmeister zwar im Besitze dieses Landen zu schützen aber gehalten seien, die Kühsenern fortan jährlich eine zweite Tonne Bier dafür zu geben“. So geschah es dann auch, doch muss es vorher schon erhebliche Auseinandersetzungen um die erste Tonne Bier gegeben haben, denn man war sich anscheinend nicht einig, wofür sie bezahlt wurde, ob für Mitbenutzung der Freiweide oder für umgebrochenes Land daraus. Schriftliche Verträge gab es nicht. Darum wurden vom Amt alte Einwohner Kühsens befragt. So wurde 1737 von „Frau Anna Ehlers, so 100 Jahre sein soll … ausgesaget: dass das Land für etwan 80 Jahre Heyde gewesen, auch dieselbe solches mit der Kühsner Vieh behütet, nachher aber dem Schleusenmeister von den Kühsenern verstattet, etwas von dem Lande aufzubrechen und weiter gepflüget“. Sie erklärte, die Tonne Bier wäre für die Mitweide auf der Gemeinweide. Einige andere alte Leute, Hans Lemcke, Hans Pantelmann und Peter Dencker, die 1742 noch einmal vom Förster Wiegers in Anker vernommen wurden, gaben die gleiche Erklärung ab. So heißt es z.B. von H. Lemcke, dass er fast 80 Jahre alt, hier geboren und erzogen sei und nun auf dem Altenteil wäre. Er wüsste ebenfalls noch, dass der Heidberg mit Busch und Holz bestanden gewesen wäre und dann gerodet worden sei.
Nach der Durchführung der Verkoppelung in den Jahren 1774 – 78 verweigerte der Schleusenmeister den Kühsenern die Bierlieferung, weil die Gemeinde gänzlich aufgehoben wurde.
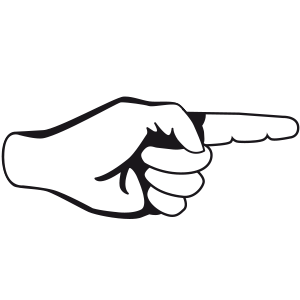
Mit einem Doppelklick/ Doppeltippen zwischen Textansicht und Orinaldokument umschalten.
Darum wurden am 27.1.1792 der Bauernvogt Krützmann und Hans Hinrich Prüsmann auf dem Amt vorstellig – der Schleusenmeister Heinaths war ebenfalls geladen – und forderten die weiter Bierlieferung. Die Begründung des Schleusenmeisters, das Bier gelte für die Weide und die sei aufgehoben, wurde ihm aus den Akten widerlegt. Das gelte nur für die eine Tonne Bier wurde ihm bedeutet, er die zweite jedoch für das Land, das er noch bearbeite, auch weiterhin bezahlen müsse. Diesem Argument konnte sich Heinaths nicht widersetzen, und so erklärte er sich bereit, „der Dorfschaft auf Johannistag jeden Jahres eine Tonne Bier zu geben“, die Dorfschaft müsste aber auf die Nachlieferung für die vergangenen 12 Jahre verzichten und „die zweite Tonne Bier auf ewige Zeiten wegfallen“. „Der Bauernvogt und Prüsmann waren mit der Erklärung zufrieden und ließen nicht allein die Forderung von den verflossenen Jahren, sondern auch die 2te Tonne Bier fahren“.
Nun trat aber das Amt auf und stellte der Kammer in Hannover vor: „Eine andere Frage ist aber, ob die Dorfschaft diese Tonne Bier verlangen könne? Und hierin sind wir der Meinung, dass diese Tonne Bier der allergnädigsten Herrschaft zufließen müsse“, weil die Dorfschaft mit der Verkoppelung abgefunden wäre und die Ansprüche an die Herrschaft, „die die Abfindung übernommen hat“, gefallen wären. Es wird auf einen ähnlichen Fall in Sirksfelde hingewiesen. Die Kammer weist aber nach, dass der Fall in Sirksfelde anders liegt und (rot angestrichen!) „erwehnte Abgift vornehmlich wegen solchen Landes entrichtet sey, welches die Schleusenmeister nach und nach aus der Gemeinheit gebrochen und wie vor behalten haben. Solchem nach ist ihnen die verabredete Tonne Bier zu überlassen und von Amts wegen kein Anspruch daran zu machen“. Das Amt versucht noch einen Vorstoß, indem es darauf hinweist, dass der von der Kammer erläuterte „ähnliche Fall“ nicht der sein, den das Amt hiebei vor Augen gehabt hätte, doch erklärt die Kammer dazu nur: „Den übrigen Inhalt obgedachten Berichtes lassen wir uns zur Nachricht dienen“.